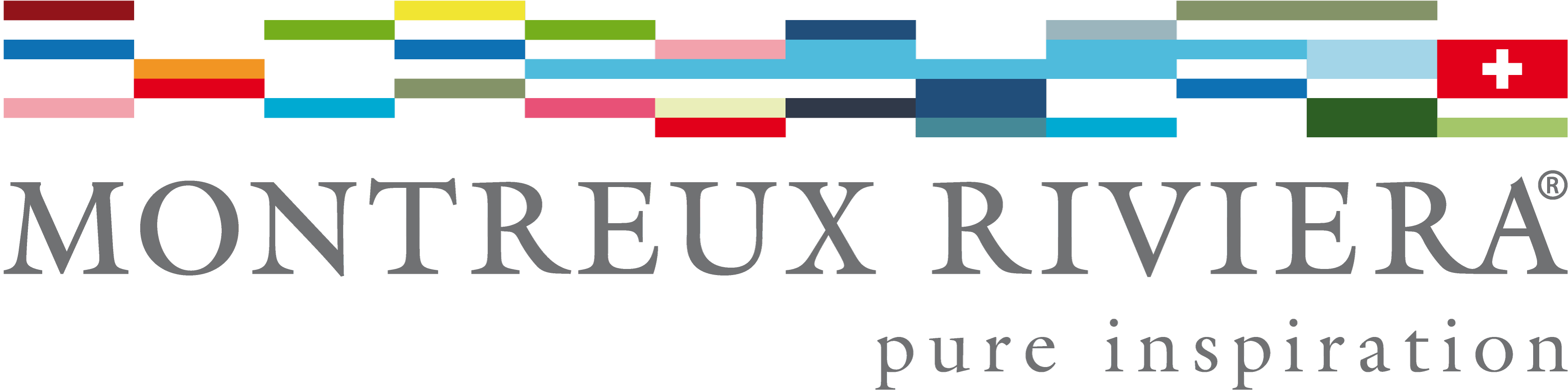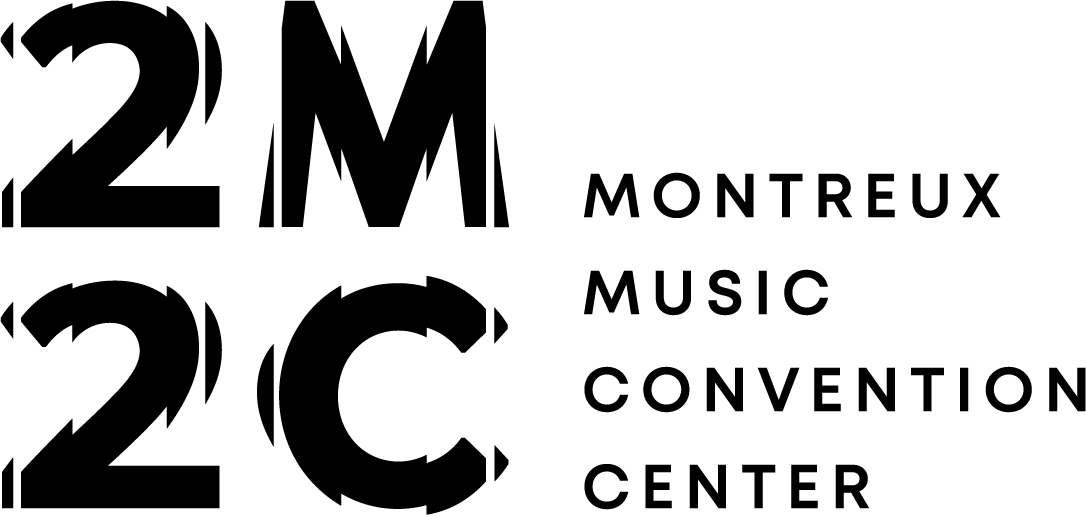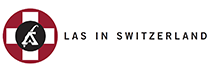Nach der Pflicht die Kür
Eine endlose Geschichte? Fluch oder Segen? Der Ruhestand und die damit verbundenen Herausforderungen standen im Mittelpunkt der mittlerweile traditionellen AVENA-Biennale, die am 9. September 2025 im Musée Olympique in Lausanne stattfand. Über 100 Personen lauschten gespannt den Ausführungen von Sophie Galabru, Philosophin, und von Matthieu Leimgruber, Geschichtsprofessor an der Universität Zürich. Derweil nutzten Francis Bouvier, Verwalter der AVENA, und Catherine Vogt, Stiftungsratspräsidentin, die Gelegenheit, die Anwesenden über die jüngsten Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge und bei AVENA zu informieren. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Chefredaktor des Magazins PME, Thierry Vial.
Eine anhaltende Debatte
Wer finanziert die AHV? Wie teilen sich Staat, Unternehmen und Einzelpersonen die Aufgaben und Zuständigkeiten? Darüber wurde schon vor 100 Jahren diskutiert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Diskussion etwas mehr Form an. Sie wird bis zum heutigen Tag weitergeführt. Während viele den «Sieg der AHV» im Jahr 1947 als Wendepunkt in der Entwicklung der Schweizer Altersvorsorge sehen, verortet Mattieu Leimgruber diesen vielmehr im Jahr 1972. Damals lehnte das Volk die «Super-AHV» ab und entschied sich stattdessen für das Drei-Säulen-System.
Markiert das Jahr 2025 den Beginn eines neuen Kapitels in diesem Abenteuer? Noch ist es zu früh, um diese Frage beantworten zu können. Doch gemäss Leimgruber bringt 2025 eine folgenreiche Neuerung: die steigende Politisierung der dritten Säule. Wenn er an die Zukunft denkt – etwas ungewohnt für einen Historiker –, ist er sich sicher: Solange es eine Schweiz gibt, gibt es eine Altersvorsorge. Deren Ausgestaltung stehe allerdings nach wie vor zur Debatte. Laut Leimgruber werden die Meinungsverschiedenheiten rund um die Grenzen und Rollen der drei Säulen des Schweizer Vorsorgesystems anhalten. Er räumt der ersten Säule einen Vorsprung auf die anderen beiden ein.
Die Zukunft gestalten
Nach der Pflicht die Kür. Der Ruhestand und das Zurücklassen einer Rolle, die durch den Beruf definiert war, kann laut der Philosophin Sopie Galabru eine Identitätskrise auslösen. Sie spricht von einer «narzisstischen Kränkung durch den Ruhestand». Der Wechsel ist abrupt und der dritte Lebensabschnitt wird immer länger. Es lohnt sich daher, ihn aktiv zu gestalten. Dabei geht es in erster Linie darum, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu überdenken, das Altern nicht nur mit dem Verfliegen der Jahre gleichzusetzen und der Vergangenheit nicht nachzutrauern. Vielmehr bietet der Ruhestand die Gelegenheit, soziale Kontakte zu pflegen, das Leben zu geniessen, seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und vor allem, aktiv zu bleiben.
Gemäss Galabru sollte man auch im Alter offen für unvorhergesehene Chancen sein und Pläne schmieden. Schliesslich sei es ein Geschenk an die jüngeren Generationen, wenn wir ihnen diesen unbeschwerten Umgang mit dem Altern vorleben.
Eine Stiftung, die wächst
Auch bei der täglichen Verwaltung der Pensionskassen spielt die Zeit eine Rolle. Francis Bouvier betonte, dass es in diesem Umfeld, das in Generationen denkt, bestimmt nichts Dringendes gebe. Dies bedeute jedoch nicht, dass man untätig bleibe. Und AVENA entwickelt sich weiter: Die Stiftung ist in den letzten zehn Jahren um über 100% gewachsen. Wenn etwas dringend sei, betonte Catherine Vogt, dann sei dies die Verbesserung der Kommunikation rund um die zweite Säule. Die Pensionskassen müssten sich dem etwas verstaubten Image der beruflichen Vorsorge annehmen. Denn sie sind es, die dafür verantwortlich sind, alle Beteiligten mit der beruflichen Vorsorge vertraut zu machen.
AVENA befasst sich seit mehreren Jahren mit dieser Thematik. Sie organisiert Informationsabende für die Versicherten, um ihnen die nötigen Kenntnisse zu vermitteln, die es braucht, um nicht nur das System als Ganzes, sondern auch die eigene Situation zu verstehen. Auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gehen nicht vergessen: Um die Herausforderungen für Arbeitgeber/innen rund um die berufliche Vorsorge zur Sprache zu bringen, schloss sich AVENA mit wichtigen Akteuren zusammen, darunter dem Magazin PME und der Waadtländer Industrie- und Handelskammer (Chambre Vaudoise du commerce et de l’industrie, CVCI). «Die BVG-Beiträge stellen für alle Unternehmen einen gewichtigen Teil der Lohnsumme dar. Es lohnt sich, sie als Werkzeug der Personalpolitik zu betrachten, das zur Attraktivität eines Arbeitgebers beitragen kann», erklärt Catherine Vogt und betont dabei den Begriff der «Vereinfachung».
Klare Informationen
Kommunikation bedeutet, dass wichtige Informationen unverzüglich an alle Betroffenen weitergeleitet werden. Dies hat sich auch Francis Bouvier zu Herzen genommen und die Versicherten mit den anstehenden Neuerungen vertraut gemacht. Ein Beispiel dafür ist der zeitlich befristete Rentenzuschlag. Dieser entspricht dem Wunsch, zu Beginn des neuen Lebensabschnitts auf ein höheres Einkommen zählen zu können, während die Bedürfnisse zehn Jahre nach der Pensionierung oftmals tiefer sind.
Rente oder Kapital? Eine brennende Frage, denn es gibt immer mehr Pensionierte – gemäss einigen Daten sind sie bereits in der Mehrzahl –, die sich für eine Kapitalauszahlung entscheiden. Bei AVENA ist der Anteil der Personen, die sich für die Rente entscheiden, von 60% im Jahr 2020 auf 50% im Jahr 2024 gesunken. Dies sowohl zugunsten des Kapitalbezugs (2024: 39%) als auch des gemischten Bezugs (11%).
Was nun? AVENA stellt in Kürze einen «Ruhestands-Check-up» bereit, der bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Die Informationen dazu werden bald auf einer vollständig überarbeiteten Website verfügbar sein.
Die nächste Biennale findet 2027 statt – zum fünfzigjährigen Bestehen von AVENA, wie Catherine Vogt in Erinnerung ruft.